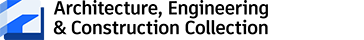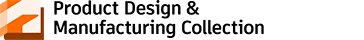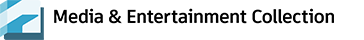Doch längst arbeiten Konstrukteure an Systemen, die diese Einschränkungen nichtig machen könnten. Ziel ist es, Baustoffe aus Bambus so praxistauglich wie Bauholz zu machen und dabei die besonderen ästhetischen Eigenschaften der Pflanze, wie die harmonische Segmentierung und die natürliche Textur, zu erhalten. Vor dem Hintergrund, dass der Klimawandel besonders den Entwicklungsländern in den Tropen zu schaffen macht, scheint es geradezu segensreich, Hochbauten potenziell mit einem Baustoff zu errichten, der die CO2-Bilanz verbessern und damit Teil der Lösung für diese Probleme sein könnte. „Wir beginnen gerade erst, das Potenzial von Bambus als Baustoff zu begreifen“, mein Gomes.
Mit Bambus werden oft ganz bestimmte Orte und Umgebungen assoziiert. Der Anblick von Bauwerken aus Bambus erinnert viele unweigerlich an einen tropischen Regenschauer und exotische Vögel, die am Horizont entlang fliegen. Bambus kann eine echte Hommage an ferne Orte sein, so zum Beispiel, wenn das Material in Luxushotels verbaut wird. Dies wird manchmal auf die Spitze getrieben, sodass das Material oft seinen ursprünglichen Charakter verliert. „Bambus wird entweder mit anspruchsloser provisorischer Architektur in Asien oder Mittelamerika oder aber mit kitschigen Südseeklischees in Verbindung gebracht”, meint Katie MacDonald. Sie ist Professorin für Architektur an der University of Tennessee in Knoxville und befasst sich mit dem Einsatz von Bambus.
„Um die Anwendungsmöglichkeiten von Bambus wirklich zu erweitern, brauchen wir neuartige und dynamische Verbindungssysteme, mit denen sich die unterschiedlich ausgebildeten Enden effizient verbinden und deren Ungleichmäßigkeiten ausgleichen lassen“, sagt Elora Hardy, Gründerin von Ibuku, einem auf Bambus spezialisierten Architekturbüro aus Bali. Das Unternehmen nutzt Autodesk AutoCAD und hat damit unter anderem das beeindruckende Öko-Resort Bambu Indah entworfen.
Inzwischen wird dieser Gedanke von vielen Architekten aufgegriffen. So hat das American Institute of Architects für die Forschungsarbeit von MacDonald Mittel in Höhe von 30.000 US-Dollar (ca. 27.000 Euro) aus der Upjohn-Initiative bereitgestellt. Gemeinsam mit ihrem Kollegen Kyle Schumann von der University of Tennessee in Knoxville und Jonas Hauptman von Virginia Tech sollen damit Fertigungssysteme für Bambus entwickelt werden, von denen man sich mehr Vielseitigkeit bei der Verbindung von Bambus-Bauteilen verspricht. Einige Bambussorten weisen einen geringeren Hohlraumanteil im Querschnitt auf. Das Team verwendet diese Sorten und kann die Stäbe in Längsrichtung begradigen. „Dadurch können wir flache Bauteile herstellen, die eher an Holzplatten erinnern“, sagt Schumann.