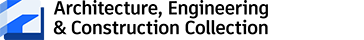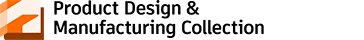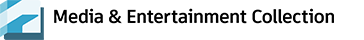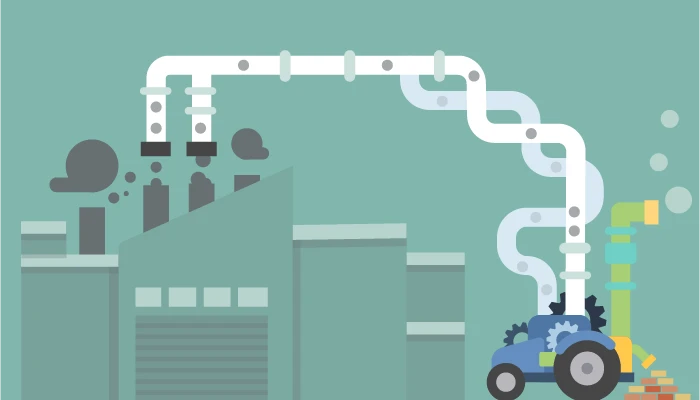Die Klimakrise polarisiert. Dabei leisten weder die Weltuntergangspropheten noch die Prediger des „Klimalüge“-Evangeliums einen konstruktiven Beitrag zur Debatte. Pragmatische Stimmen, die Mittelwege zwischen Hysterie und Realitätsverweigerung aufzuzeigen versuchen, können sich in dieser Kakophonie der Meinungsextreme nur mit Mühe Gehör verschaffen. Ein Plädoyer.
Wer sich noch an die 1970er-Jahre erinnert, dem kommt das alles irgendwie bekannt vor: Damals löste die Diskussion um Umweltverschmutzung und Überbevölkerung ähnliche Wechselwirkungen zwischen Panikmache auf der einen und Verharmlosung auf der anderen Seite aus. Es gab durchaus Menschen, die den Standpunkt vertraten: alles halb so wild, machen wir ruhig weiter wie gehabt!
Am anderen Ende des Spektrums machte sich Weltuntergangsstimmung breit. Populäre Filme und Bücher entwarfen ein dystopisches Zukunftsszenario nach dem anderen: vom Waldsterben in „Lautlos im Weltraum“ (1972) über Hungersnot und Kannibalismus in „… Jahr 2022 … die überleben wollen“ (1973) bis hin zur Explosion der „Bevölkerungsbombe“ in Paul R. Ehrlichs gleichnamigem Sachbuch von 1968. Eine besonnene Bestandsaufnahme – geschweige denn die Verabschiedung effektiver umweltpolitischer Maßnahmen – wurde erst möglich, nachdem die anfängliche Panik abgeklungen war.
Zu diesen Maßnahmen zählte neben der Erarbeitung umweltpolitischer Programme und Verabschiedung entsprechender Gesetze auf nationaler wie auch internationaler Ebene etwa die Einberufung der ersten internationalen Umweltkonferenz der Vereinten Nationen in Stockholm. Technische Innovationen (die Ausstattung von Neuwagen mit Katalysatoren oder die Einführung von Abgasentschwefelungsanlagen für Kohle- und Gaskraftwerke sowie die Revolution der Lebensmitteltechnologie zur Versorgung der Weltbevölkerung, die sich seit 1960 mehr als verdoppelt hat) schürten die Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Selbst im Autofahrerland USA investierte man in den öffentlichen Nah- und Fernverkehr als umweltfreundliche Alternative.
Dass all dies zur Verhinderung der akuten Klimakrise nicht ausreichte, pfeifen heute die Spatzen – inzwischen selbst eine gefährdete Art – von den Dächern. Untätigkeit können wir uns nicht leisten.
Ebenso sinnlos ist jedoch der Versuch, die Mitmenschen mit Katastrophenmeldungen in panische „Öko-Angst“ zu versetzen und zu einem blinden Aktionismus aufzurufen, der bestenfalls ergebnislos bleibt und schlimmstenfalls unbeabsichtigte Folgen hat. Damit ein nachhaltiger Wandel und eine Annäherung zwischen den polarisierten Lagern denkbar wird, sind ehrgeizige politische Maßnahmen, anhaltende technische Innovation und massive Investitionen in die energetische Infrastruktur erforderlich – und zwar lieber gestern als heute.