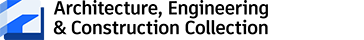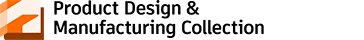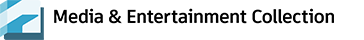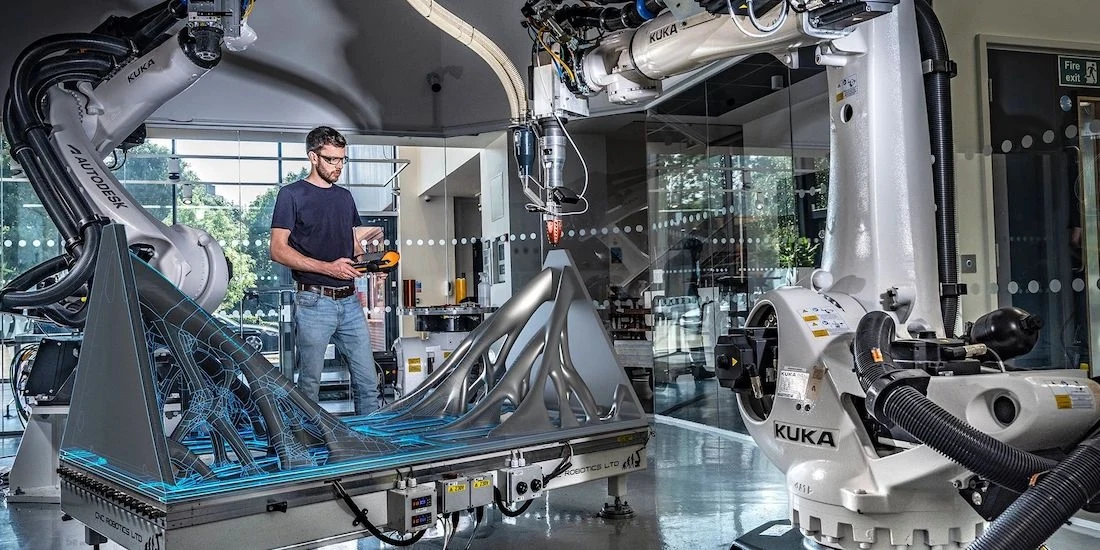Ende März organisierte die deutsche Bundesregierung einen Hackathon unter dem Hashtag #WirvsVirus und mit dem Ziel, verschiedenste Lösungen im Kampf gegen das Coronavirus digital zu generieren. Jeder, der an einer Teilnahme interessiert war und Ideen einbringen wollte, konnte ein Team gründen und innerhalb von 48 Stunden ein Konzept entwerfen oder den ersten Prototypen einer App programmieren.
Unter den 28.361 Teilnehmern des Hackathons waren auch 15 Studierende und Jungingenieure des Vereins Deutscher Ingenieure (VDI). Angestoßen von Andreas Stutz, Entwicklungsingenieur bei Siemens, konzipierte ein Team aus Softwareentwicklern, Informatikern, Naturwissenschaftlern, Maschinenbauern und Ingenieuren die App „Deeper“. Mithilfe dieser App soll der Nutzer den Krankheitsverlauf kontrollieren und herausfinden können, ob er sich in Gebieten mit erhöhter Infektionsgefahr aufgehalten hat.
Die App ist eine Kreuzung aus der vom Robert-Koch-Institut entwickelten Corona-Datenspende, der CovApp der Berliner Charité, die ebenfalls Symptome des Nutzers abfragt und am Ende eine Handlungsanweisung generiert, sowie der in Deutschland geplanten dezentralen Kontakt-Tracing-App. Weil es all diese Ansätze schon gibt, hat sich das Team um Andreas Stutz und Torben Deppe, Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der RWTH Aachen, entschieden, lediglich seinen wahrscheinlichkeitsbasierten Algorithmus auf einer Open-Source-Plattform anderen Entwicklern zur Verfügung zu stellen.
Auf die Frage, warum so viele Ingenieure an der App-Entwicklung beteiligt waren, antwortet Stutz: „Einige von uns haben beruflich mit Softwareentwicklung zu tun, ich selbst arbeite im Forschungsbereich für zukünftige Architekturen für Prozessleitsysteme. Viele unserer Studenten entwickeln während des Studiums Software.“ Jedoch kämen die Kenntnisse und Kompetenzen überwiegend von Tätigkeiten und Eigeninitiativen, die außerhalb des Studiums erlangt wurden, fügt Stutz hinzu.