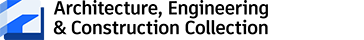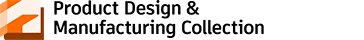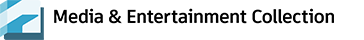Nach der Fertigstellung musste sich der Prototyp in der Praxis bewähren. Als Testareal fiel die Wahl auf die japanische Präfektur Kagawa im Nordosten der Insel Shikoku, die eine hohe landwirtschaftliche Prägung aufweist. Der fruchtbare Boden Kagawas eignet sich hervorragend für den Anbau verschiedener Pflanzen, auch wenn in der Region nur wenig Regen fällt. Zur Bewältigung dieses Mankos haben die Einheimischen jedoch schon in historischen Zeiten mit dem Manno-See ein nachhaltiges Wasserreservoir angelegt.
Für die dortige Schwimmprüfung des Prototyps wurde zusammen mit den Landwirten aus der Region eigens eine Prüfanlage errichtet, wobei auch die für den Anlagenbetrieb benötigte Energie selbst erzeugt wurde. Zur weiteren Unterstützung wurde Misao Mizuno hinzugezogen, ein Experte auf den Gebieten computergestützte Entwicklung, Baustatik und Fluiddynamik. Anhand von Simulationen analysierte er, ob das Modell den vorgegebenen Leistungsanforderungen gerecht wurde.
„Computersimulationen beschleunigen den Entwicklungsprozess und führen zu einer geringeren validierungsbedingten Abfallproduktion, da weniger physische Tests erforderlich sind“, erläutert Yanagisawa. Ursprünglich war vorgesehen, den Prototyp fünf bis sechs Monate lang zu erproben. Da jedoch die meisten Tests simuliert werden konnten, verkürzte sich diese Zeit auf lediglich zwei Monate.
Nach diesem Zeitraum bestätigte sich, dass die Schwimmkörper ordnungsgemäß funktionierten, und die Massenfertigung konnte beginnen. Yanagisawa war zufrieden: „Unser System hat die Erwartungen erfüllt. Aufgrund mangelnder standardisierter Sicherheitsbestimmungen findet es vorerst zwar nur auf einigen Feldern im asiatischen Raum Anwendung, aber auch einige europäische Unternehmen zeigen Interesse.“
Als Emerging Market mangelt es der Photovoltaik bislang noch an einigen neuen Regelungen, bevor sich Unternehmen an großflächige Investitionen wagen. Doch die Technologie ist weiter im Kommen, nicht zuletzt dank Generativem Design, mit dem sich in kürzester Zeit vielfältige Prototypen erstellen und schwimmende Solaranlagen prüfen lassen. Somit ist es eventuell nur eine Frage der Zeit, bis sie den Markt endgültig erobern.