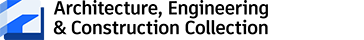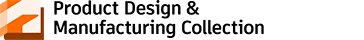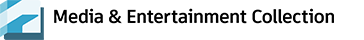Es kommt der Punkt, an dem eine Sanierung sich nicht mehr rechnet. Derzeit sind Mitarbeitende der Bereiche Planung, Hydrologie, Entwurf und Ingenieurwesen bemüht, frühere Prognosen zu extremen Wetterereignissen zu überarbeiten, um sich auf die im Zuge des Klimawandels zu erwartenden Veränderungen und stärkeren Niederschläge vorbereiten zu können. Infrastruktursysteme müssen künftig in der Lage sein, umfangreiche Schäden zu kompensieren, damit Straßensperrungen und vor allem Todesfälle vermieden werden. Traditionell sind Auffangsysteme für Niederschlagswasser auf 50-jährliche Hochwasser ausgerichtet, zukünftig müssen sie aber voraussichtlich für stärkere 500-jährliche Hochwasser gewappnet sein.
„Wir haben es nicht länger mit einem überschaubaren kleinen Aufwärtstrend der [Klimawandel-]Kurve zu tun, sondern mit einem rasanten Anstieg“, warnt Runyen weiter. „Wir dürfen uns da nichts vormachen: Die Situation wird sich exponentiell schnell verändern.“
Auf Resilienz bedachte Entwurfsstrategien berücksichtigen neben widerstandsfähigeren Materialien auch Optionen wie das Anheben von Straßen und Brücken, den Bau von Straßen in größerem Abstand zu Wasserläufen und eine veränderte Anordnung oder Gestaltung struktureller Elemente.
Neue Methoden zur Modellierung und Prüfung von Materialstärken befinden sich bereits in Entwicklung. Das INDOT evaluiert derzeit in Zusammenarbeit mit der in West Lafayette in Indiana gelegenen Purdue University Sensoren, mit denen sich erkennen lässt, wann Beton die den jeweiligen Anforderungen genügende Festigkeit erreicht hat. Vom Bundesstaat Indiana beauftragte Ingenieursteams prüfen darüber hinaus mittels Fallgewichtsgeräten die Elastizität verschiedener Straßenoberbauten, um deren jeweilige Schwerlastresilienz zu ermitteln.
An Methoden, um der Erosion von Dämmen und Deichen Einhalt zu gebieten, wird ebenfalls aktiv geforscht. So hat das PennDOT Forschende der Lehigh University hinzugezogen, um Hinterfüllungstechniken zum Schutz von brückennahen Verkehrswegen, bei denen ein Auswaschungsrisiko besteht, auszuwerten. Eine dieser Techniken setzt auf eine Verstärkung aus grobkörnigem Material, Gestein als Füllmaterial und geosynthetischen Dichtungsbahnen hinter den Widerlagern der Brücke. Die eng gebundene Matrix fixiert das Hinterfüllungsmaterial und gewährleistet damit die Funktionsfähigkeit der Straße bei einem Hochwasser sowie kurz danach.
„Wenn Sie nach Italien und dort auf Venedig schauen, entdecken Sie diese riesigen Betonelemente, die zum Schutz vor Springtiden dienen“, erläutert Runyen. „Dabei geht es darum, Energie aufzunehmen und das Wasser von den empfindlichen Fundamenten fernzuhalten. Erreicht das Hochwasser jedoch einen bestimmten Pegel, werden diese Schutzelemente nach und nach fortgespült. Deshalb haben wir unterschiedliche Materialien für eine Art Matrix erforscht, die einerseits länger an Ort und Stelle verbleibt, andererseits aber auch die Umwelt schont.“
Finanzierungsgelder im Zuge des Infrastructure Investment and Jobs Act, einem US-Gesetz für Investitionen und die Schaffung von Arbeitsplätzen im Bereich Infrastruktur, könnten derartige Forschungsbemühungen weiter vorantreiben. Teil dieses Gesetzes ist das PROTECT-Programm zur Unterstützung der Resilienzplanung für den Landverkehr, in dessen Rahmen der Bundesstaat Indiana erst kürzlich staatliche Fördermittel in Höhe von umgerechnet etwa 560.000 Euro erhalten hat und aus dem das PennDOT jährliche Fördermittel von umgerechnet etwa 46,6 Millionen Euro einplant.
Sowohl für Pennsylvania als auch Indiana ist es noch ein weiter Weg, bis sie die positiven Langzeiteffekte in Bezug auf Kosten, Energie, Menschenleben und Kohlenstoffemissionen prognostizieren können, denn es braucht Zeit, neue Brücken- und Straßenentwürfe sowie Materialien zu prüfen oder Richtlinien für resiliente Assets zu entwickeln. Doch laut Runyen ist es höchste Zeit dafür.
„Das Ingenieurwesen muss seine Komfortzone verlassen“, sagt er. „Das Thema Resilienz setzt uns unter echten Druck, unsere für das Heute konzipierten Entwürfe zu überdenken. Das bedeutet nichts anderes, als das Resilienz und Technologieoptimierung Hand in Hand gehen müssen: Je umfangreicher Organisationen auf fortschrittliche digitale Tools und Arbeitsabläufe setzen, desto besser sind sie in der Lage, den mit dem Klimawandel und Extremwetter verbundenen Herausforderungen entgegenzutreten, die Lebensdauer von Bestandsbauten zu verlängern und sich zukunftssicher aufzustellen.“